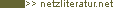
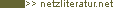 |
Literatur im Internet. Oder. Wen kümmert's wer liest?von Uwe Wirth In: Mythos Internet, hg. v. Stefan Münker und Alexander Roesler, Frankfurt: Edition Suhrkamp 1997, S.319-337.
Im Kontext der Internet-Literatur wird eben jenes Konzept, das Flannery als Romanhandlung entwirft, zum Strukturmerkmal des hypertextuell organisierten Diskurses. Hypertexte legen es darauf an, den Lesefluß durch untereinander vernetzte Verweise, sogenannte "Links", zu unterbrechen und den Leser in einen "Taumel der Möglichkeiten" zu stürzen. Die zentrale Organisationsidee des Hypertextes ist die Vernetzung der Links mit andern Links. Dieses Netz aus Verweisen hat eine zentrifugale Wirkung. Das Link ist die hypertextuelle Aufforderung an den Leser einen rezeptiven Sprung zwischen verschiedenen Fragmenten oder zwischen verschiedenen Ebenen zu vollziehen. Dabei läßt sich der Hypertext, der explizit als unabschließbarer "Text in Bewegung" konzipiert ist, nicht zuendelesen. Man hat einen Text vor sich, der im Grunde nur aus alternativen Textanfängen besteht. Literatur im Internet ist zugleich Spiegel und Bestandteil der durch das Internet etablierten Textlandschaft. Zwischen Literatur im Internet und dem Internet selbst besteht sowohl eine syneckdochische pars-pro-toto Beziehung als auch eine metaphorische. Literatur im Internet ist eine "epistemologische Metapher", sie repräsentiert ein "diffuses theoretisches Bewußtsein" (Eco 1977: 160), gespeist von den technischen Möglichkeiten des Computerzeitalters und den ästhetischen Konzepten der Postmoderne. Dies wird nach einem Blick auf den Internet-Index Hyperizons deutlich, der eine kommentierte Bibliographie zur Theorie und Technik von Hypertextliteratur anbietet. Da ist vom "Ende des Buches" (Robert Coover) die Rede, an dessen Stelle ein "elektorinisches Labyrinth" tritt, von den "Versprechen und Enttäuschungen" der "Hypertextfiction" (Jurgen Fauth) oder vom "Psychodrama der Interaktivität" (Christian Paul). Betrachtet man die Literatur im Internet selbst, so stellt man bald fest: Das Hauptaugenmerk der Macher und Kritiker von Online-Texten richtet sich weniger auf deren stilistische Qualitäten, als vielmehr darauf, wie die "Hypertextmaschine" im Kontext der lesergesteuerten Aktivitäten des Hin- und Herschaltens zwischen verschiedenen Textebenen und Links funktioniert. Es geht weniger um den Stil des Schreibens als um den Stil des Lesens. Schreiben im Netzwerk hat, so Idensen, "nicht im klassischen Sinne mit Literatur zu tun". Vielmehr geht es darum, "Neuland im telematischen Raum zu vermessen, Textlandschaften anzulegen, Schreiben und Lesen eben auch als einen nomadischen Akt des Umherschweifens durch Text-Netzwerke zu begreifen" (Idensen 1996: 155). Dabei muß gefragt werden, inwieweit das "Lesen von hypertextuellen Strukturen" "neue Formen des Lesens" impliziert (vgl. Wingert 1995: 113). Wird das Lesen zu einer lecture automatique? Mehr als durch neue Themen und Formen ist diese Literatur durch die
Frage nach der Rolle des Lesers bestimmt. Was muß ein Leser können
und wissen, um Literatur im Internet rezipieren zu können? Ist
er umherschweifender Daten-Dandy oder sinnsuchender Daten-Detektiv?
In beiden Fällen gilt, was Proust im letzten Band seiner Suche
nach der verlorenen Zeit schreibt: "In Wirklichkeit ist jeder Leser,
wenn er liest, ein Leser nur seiner selbst" (Proust 1957: 329). Ich
möchte im folgenden klären, was dieser Gedanke bedeutet, wenn
man ihn im Kontext der Literatur im Internet und vor dem Hintergrund
jener literatur- und texttheoretischen Konzepte betrachtet, die für
die Idee hypertextuell orientierten Lesens relevant sind. "Bin auf den Gedanken gekommen, einen Roman zu schreiben, der
nur aus lauter Romananfängen besteht. Der Held könnte ein
Leser sein, der ständig beim Lesen unterbrochen wird. (...) Ich
könnte das Ganze in der zweiten Person schreiben: du, Leser ..."
(Calvino 1983: 237). I. Paul de Man prägt in seinem berühmten Essay über das Lesen den dekonstruktivistischen Slogan, daß das "Lesen die Metapher des Schreibens" sei (de Man 1988: 101). Der Hypertext ist das Wörtlichnehmen der Metapher vom Lesen als Schreiben im Zeichen interaktiver Computermedien. Freilich mit den bekannten Fogen, die das Wörtlichnehmen von Metaphern so mit sich bringt: die ganze Sache kippt entweder ins Banale oder ins Bizarre. Daß sich der Mythos der Literatur im Internet aus wörtlich genommenen Metaphern postmoderner Literaturtheorien speist, läßt sich an zwei Beispielen plausibel machen: Einmal anhand der Idee vom Hypertext als einer rhizomatisch vernetzten Karte. Zum anderen anhand der Idee vom Hypertext als offenem Text, der in seiner Abfolge erst im Akt des Lesens entsteht. Das Programm des Hypertextes lautet auf Seiten dessen, der den Hypertext strukturiert: "Löse den Text in seine Bestandteile auf und organisiere diese Teile neu" (Wingert 1995: 112). Mit Hilfe dieses Verfahrens, das sehr der Bartheschen Beschreibung der "strukturalistischen Tätigkeit" ähnelt, lassen sich Texte und Argumentationen entweder entwirren oder verwirren. Der Hypertext kann also im Dienst der diskursiven Transparenz stehen oder aber, etwa im literarisch-ästhetischen Kontext, der Verrätselung diskursiver Strategien dienen, um absichtlich die Verstehbarkeit des Textes zu erschweren. Gerade im literarisch-ästhetischen Kontext können die intra- und intertextuellen Verweise auch falsche Fährten eines "gigantischen Versteckspiels" sein. Hieraus entwickelt sich die häufig zitierte Idee vom Hypertext als einem "rhizomatischen Labyrinth". Der von Deleuze aus dem Feld der Biologie in das Feld der Philosophie übertagene Begriff bezieht sich auf ein unstrukturieretes Geflecht. So wird das Rhizom zum Modell des Internet und seiner hypertextuellen Teiltexte, die durch Links miteinenader vernetzt eine virtuelle Bibliothek bilden. Auch im Fall des Rhizoms handelt es sich um eine Metapher postmoderner Theorie, die im Zeitalter ihrer technischen Realisierbarkeit ins Wörtliche kippt. Rhizomatischen Verknüpfungsweisen, öffnen nach Idensen, "einen neuen Raum für textuelle, konversationelle und diskursive Austauschprozese" (Idensen 1996: 155). Im gleichen Maße verschließen sie sie aber auch, da sie zu einer "semantischen Orientierungslosigkeit" des Lesers beitragen. "Alles hing mit allem zusammen, alles konnte mysteriöse Analogien mit allem haben", heißt es in Umberto Ecos Roman Das Foucaultsche Pendel (196). Und genau dies scheint auch das Grundmuster des Rhizoms zu sein. Nach Eco ist das rhizomatische Labyrinth "vieldimensional vernetzt", es "hat weder ein Zentrum, noch eine Peripherie" und ist "potentiell unendlich" (Eco 1984: 65). Nach Eco ist ein Rhizom "eine offene Karte, die in all ihren Dimensionen mit etwas anderem verbunden werden kann; es kann abgebaut, umgedreht und beständig verändert werden" (Eco 1985: 126??). Überall findet man in der Auseinandersetzung mit dem Konzept des Internet und mit der Poetik der Literatur im Internet (und oft auch in der Literatur selbst) den Hinweis auf die legendäre "Bibliothek von Babel". Diese Bibliothek, die Borges beschreibt, ist als rhizomförmiges Labyrinth angelegt, sie ist "unbegrenzt und zyklisch" (63). Dabei wird die Bibliothek zur Metapher der Welt: "Das Universum (das andere die Bibliothek nennen) setzt sich aus einer unbegrenzten und vielleicht unendlichen Zahl sechseckiger Galerien zusammen" (54). Ebenso wie das Rhizom ist die "Bibliothek von Babel" Peripherie ohne Mittelpunkt. Sie ist "eine Sphäre, deren eigentlicher Mittelpunkt jedes beliebige Sechseck, und deren Umfang unzugänglich ist" (56). Aufgrung seiner räumlichen Anordnung wird das Lesen von Hypertexten zum "topografischen Lesen" einer hypertextuellen "Weltkarte des Wissens". Das Problem, sich innerhalb der rhizomatischen "Landkarte der Semiose" zu orientieren, gleicht dem Problem, eine Karte zu lesen, ohne den eigenen Standpunkt zu kennen. Die Aufgabe eine Karte lesend zu interpretieren und sich mit ihrer Hilfe zu orientieren gleicht der hermeneutischen, zwischen Text und Lebenswelt verstehend zu vermitteln. Insofern thematisiert das Lesen von Karten die Frage nach dem Standort des Denkens innerhalb eines labyrinthischen Diskurses. Wo bin ich und wo will ich hin? In dem Moment jedoch, in dem Lesen im Internet nicht mehr pragmatisch sondern ästhetisch motiviert ist, verlieren diese beiden Fragen an Relevanz. Anders als das pragmatische orientierte Kartenlesen will das ästhetische Lesen "mehr an den Dingen sehen, als sie sind" (Adorno). Zumal auch der Autor eines ästhetischen Textes auf sein "Verwirrungsrecht" pocht. Diese postmodern anmutende Idee stammt - wie viele andere auch - aus der Romantik. So lesen wir in Friedrich Schlegels Lucinde: "Für mich und für diese Schrift (...) ist aber kein Zweck zweckmäßiger als der, daß ich gleich anfangs das was wir Ordnung nennen vernichte, weit von ihr entferne und mir das Recht einer reizenden Verwirrung deutlich zueigne und durch die Tat behaupte" (Schlegel 1962: 8f). Eben dies scheint auch ein zentrales Moment im Konzept der Literatur im Internet zu sein: Der Leser hat die Freiheit die Ordnung des Diskurses selbst herzustellen oder sich von der Unordnung der Fragmente verwirren zu lassen. Bedingt durch die räumliche Anordnung des Textes kann sich der Leser vom "Zwang des Linearen" befreien, die "lesergesteuerte Selektion" wird zum Programm. An die Stelle einer vorgeschriebenen syntaktisch-textuellen Ordnung tritt eine assoziative Ordnung, die erst im und durch den Akt des Lesens etabliert wird. Dabei wird der Lesefluß in dem Maße unterbrochen, in dem der Leser seine Freiheit nutzt, sich vom aktuellen Textausschnitt zu einem anderen, zunächst marginalen Textausschnitt führen zu lassen, der durch einen Mausklick mit einem Mal ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit springt. Schlegels romantische Idee einer verwirrten Ecriture wird dabei maßstabsgetreu auf den Lektüreprozeß projiziert. Der entscheidende Unterschied - auf den auch immer wieder hingewisen wird - besteht darin, daß der hypertextuell organisierte Diskurs des Internet technisch avanciertere Formen kennt, das Recht einer reizenden Verwirrung durch die Tat zu behaupten. Um dies zu verdeutlichen muß man den Unterschied zwischen Buch und Text zur Sprache bringen. In Calvinos Roman Wenn ein Reisender in einer Winternacht möchte Flannery "im Buch die unlesbare Welt" einfangen, nämlich "die Welt ohne Mittelpunkt, ohne Ich" (1983: 217). Er steht vor der Entscheidung die Totalität der Welt darzustellen, indem er entweder ein Buch schreibt, "das zum einzigen allumfassenden Buch werden kann", oder indem er "alle Bücher" schreibt, "um das Ganze durch seine Teilbilder einzufangen" (1983: 218). Das Internet kennt dieses Dilemma scheinbar nicht. Jeder Teiltext ist automatisch Bestandteil eines allumfassenden Textes, der ständig im Entstehen begriffen ist. Im Unterschied zu Hypertexten auf CD-Rom, die immer noch etwas vom "Werkcharakter" behalten haben, ist Online Literatur im Internet potentiell jederzeit erweiterbar. Dies wird nun aber gerade dadurch möglich, daß es sich bei der Internetliteratur nicht mehr um Texte in Buchform handelt, sondern um Hypertexte. Texte also, die man aufgrund ihrer internen Verweisstruktur nicht drucken kann und die deswegen keine "realen" Grenzen haben. Die gesetzte Grenze zwischen Text und Kontext markiert der Buchdeckel. Diese Grenze entfällt im Internet. Insofern ist Literatur im Internet durch den Verlust des Buch- und Werkcharakters ausgezeichnet. Sie löst den Literaturbegriff von seinem "klassischen Träger", dem gedruckten Buch. Der Begriff des Textes ist nicht mehr an die Form des Buches gebunden. Im Internet bekommt Derrida uneingeschränkt Recht, wenn er behauptet: "There is nothing outside the text". Ja, man muß diese dekonstruktivistische Parole vielleicht sogar noch ergänzen und sagen "There is nothing outside the hypertext". Aufgrund der hypertextuellen Organisation des Diskurses realisiert sich im Internet noch ein anderes postmodernes Konzept, nämlich das der Intertextualität. Indem sie intertextuelle Strukturen inszeniert, thematisiert Internet-Literatur "den Raum zwischen verschiedenen Text-Fragmenten" (Idensen 1996: 145). Intertextualität wird gemeinhin als "Dialog zwischen Büchern" in einer unendlichen Bibliothek bezeichnet. Bei genauerem Betrachten ist Intertextualität jedoch ein Dialog zwischen Textstellen, also zwischen aufgeschlagenen Büchern. Während die Intertextualität der Druckkultur eine virtuelle ist, die sich im Gedächtnis des Interpreten herstellt, ist die Intertextualität im Netz eine sichtbargemachte. Hier treffen nicht aktueller Text und erinnerter Text aufeinander, sondern zwei gleichermaßen päsente und miteineander durch Links verbundene Texte, die auf verschiedenen Ebenen angesiedelt sind. Dabei vollzieht der Link einen "wirklichen Sprung". Dergestalt nimmt die "Hyper-Intertextualität" die Metapher vom "Text in Bewegung" wörtlich und impliziert eine Poetik des Transports (Idensen 1996: 145). Das Bewegungsmuster dieser Poetik ist der Sprung aus dem Zentrum - also das, was Eingangs die zentrifugale Wirkung der Link-Struktur genannt wurde. Ich möchte dies anhand des Internet-Romans Spielzeugland erläutern. Einer seiner möglichen Anfänge trägt den Titel "Einzug des neuen Ritters": "So stand ich ihm gegenüber. Nackt und kalt, denn ich fühlte mich zu dünn angezogen an diesem Tag. Der leichte Wind, der durch sein Zimmer strich, zerrte an meinem Hemd; ich fröstelte. Mächtig thronte er auf seinem Diwan (...)". Das Wort "thronte" ist unterstrichen. Dies zeigt an, daß
es durch ein Link, mit einer anderen Textstelle verbunden ist. Der Leser
klickt das Wort an und springt zu einer Fußnote. Dort liest er,
daß es der Ausdruck "thronte" aus Goethes Faust stammt.
Folgt man nun dem Link, das sich hinter "Faust" verbirgt, so
gelangt man aus dem Text "Spielzeugland" direkt an die entsprechende
Stelle in Goethes Faust und könnte nun dort weiterlesen.
Das Link hat die intertextuelle Verbindung zwischen der ursprünglichen
Anspielung, dem Autor und dem Text auf den sich die Anspielung bezog,
hergestellt. Der Leser kann so von einem Text zum nächsten springen.
Natürlich könnte man fragen, warum ausgerechnet der Begriff
"thronte" zum Anlaß genommen wird, um auf Goethes Faust
zu verweisen. Ebensogut hätte man den Begriff "Diwan" zum Anlaß
nehmen können, um auf Goethes "westöstlichen Diwan" zu verweisen.
Mit anderen Worten: Man kann im Prinzip von jedem Wort aus zu jedem
anderen gelangen. Informativ werden Links erst dadurch, daß sie
eine spezifische Relevanzstruktur implizieren. Oder aber dadurch, daß
der Leser die spezifische Irrelevanz eines Links erkennt. Hinter den
Kriterien, nach denen Links angeordnet werden, verbirgt sich so etwas
wie die Persönlichkeit desjenigen, der sie gesetzt hat. Die Struktur
der Links ist eine Spur, ein Abdruck einer diskrusiven Strategie. Hier
zeigt sich, ob die "Ökonomie des Diskurses" bestimmten Relevanz-
und Kohärenzkriterien folgt, oder rein willkürlich, den Leser
in die Irre leitet. Damit sind wir wieder bei unserer Ausgangsfrage
angelangt: Was muß ein Leser können und wissen, um Literatur
im Internet rezipieren zu können? Ist er umherschweifender Daten-Dandy
oder sinnsuchender Daten-Detektiv? Beide Rollen sind möglich. II. Der Leser als Detektiv hegt die Hoffnung, daß er nach denselben Gesetzen denkt, die den Zusammenhang und die Ordnung des Diskurses regeln. Er möchte die diskursive Strategie - diene sie der Entwirrung, oder aber der Verwirrung - entschlüsseln. Mit anderen Worten: Um herauszufinden, wer der Schuldige ist, muß er annehmen, daß alle Tatsachen eine Logik haben, nämlich die Logik, die ihnen der Schuldige auferlegt hat" (Eco 1984: 64). Die Rolle des Lesers ist jedoch nicht auf die des Detektivs beschränkt. Wenn wir Proust Glauben schenken, daß jeder Leser, wenn er liest, in Wirklichkeit ein Leser seiner selbst ist, dann ist der Leser zugleich auch der Schuldige. Tatsächlich ist der einzige noch nicht realisierte Detektivroman, (so eine Untersuchung des Pariser Ouvroir de Littérature Potentielle) derjenige, in welchem der Leser der Täter ist. Eco schreibt dazu: "Ich frage mich, ob dies (...) nicht überhaupt die Lösung ist, die jedes große Buch realisiert" (Eco 1988: 200). Die Mitarbeit des Lesers bei der Konstitution des Textes und der Ergänzung diskursiver Leerstellen impliziert immer auch eine Mittäterschaft. Der Leser ist also Täter und Detektiv zugleich. Einmal überläßt er sich naiv den Spüngen und Strategien des Diskurses. Dann wieder versucht er herauszufinden, wie ihn der Text zur Mitarbeit und zur Komplizenschaft aufgefordert hat. Auf dieser Ebene wird er zum "kritischen Leser" (Eco 1987c: 41.). Die "kritische Leistung" des Lesers besteht darin, im Akt des Lesens und Interpretierens seine Perspektive zu verändern, ein "switching" der diskursiven Rollen zu vollziehen. Er ist sowohl Dandy als auch Detektiv. Übertragen wir dies auf das Konzept des Lesens von Hypertexten. Die Pointe des aktiven Lesens besteht nach Flusser darin, daß der Leser selbst aus den Informationselementen, die Information überhaupt erst herstellt. Dabei vollzieht der Leser aktiv "verschiedene Knüpfmethoden, die ihm von der künstlichen Intelligenz vorgeschlagen werden" (Flusser: 1987: 150). Dabei ist nun zu fragen, inwieweit der Leser hier nur innerhalb eines vorgeschriebenen Rahmens agiert, ob er wirklich "eigene Wissenspfade abschreitet" (Idensen 1996: 149), wenn er den Knüpfmethoden folgt, die ihm von der künstlichen Intelligenz vorgeschlagen werden. Die Knüpfmethoden sind die Links zwischen verschiedenen Textelementen, denen man wie ein Spurenleser folgt. Will man, wie Wingert einen Begriff "hypertextuellen Lesens" in Analogie zum Spurenlesen entwickeln (Wingert 1995: 116), muß man sich über den Status der Links, auf denen die Wissenspfade aufbauen, im Klaren werden. Links sind keine Abdrücke unschuldiger Tiere (wie Wingert in seinem Aufsatz behauptet), sondern absichtsvoll von einem Autor oder einem Herausgeber "vorgeschriebene Verweise". Ihnen naiv zu folgen und Wissen zusammenzulesen wäre eine Form assoziativen "brain stormings", ein phantasievoller Datendandyismus, aber noch keine Form des Wissenserwerbs. Auch Flusser unterscheidet zwischen verschiedenen Formen des Lesens von Texten, die zugleich verschiedene Lesemodelle für Hypertexte implizieren: "das vorsichtige Auseinanderfalten, das hastige Überfliegen und das mißtrauische Nachschnüffeln" (Flusser 1987: 88). Dieses ist die "kritische Form des Lesens" im Gegensatz zum "wahllosen Lesen", das sprunghaft und assoziativ verfährt. Das wahllose Lesen ist nach Flusser bloßes "raten" (Flusser 1987: 79). Bei dieser Gegenüberstellung von kritischem und ratendem Lesen läßt Flusser allerdings außer acht, daß das mißtrauische Nachschnüffeln als "detektivische Form des Lesens" immer schon das Raten mit einschließt. Die assoziativen Sprünge werden in Hypothesen umgewandelt, die sich ihrerseits in Argumentationszusammenhänge integrieren und kritisch überprüfen lassen. Das Raten ist der erste Schritt beim Aufstellen und beim Selegieren von interpretativen Hypothesen. So belehrt William von Baskerville, Ecos mittelalterlicher Meisterdetektiv in Der Name der Rose: "Die erste Regel beim Entziffern einer Geheimbotschaft ist, zu raten, was sie uns sagen will" (Eco 1980: 211). Das gleiche Verfahren wendet der Leser im Internet als William von Cyberville an. Die Logik des Lesens und Interpretierens ist nach Eco die Logik der Abduktion (vgl. Eco 1987c: 45). Der abduktive Schluß ist das Herzstück jener pragmatischen Wissenschaftstheorie, die Charles Sanders Peirce, der Vater der modernen Semiotik, entwickelte. Nach Peirce vollzieht sich alles Denken und Interpretieren als Zeichenprozeß, als "Semiose". Dieser Zeichenprozeß ist zugleich Bestandteil einer Argumentationszusammenhangs. Die Abduktion ist der "Prozeß eine erklärende Hypothese zu bilden" (CP 5.171). Sie ist der erste Schritt des Argumentationskette, gefolgt von Deduktion und Induktion, welche die abduktiv aufgestellten Hypothesen logisch und empirisch überprüfen. Abduktives Folgern ist ein Gedankenspiel (Peirce nennt diese spielerische Gedankenbewegung "musement" (CP 6.460)), an dem konstruktive und rekonstruktive Momente beteiligt sind. Als "logic of discovery" bezieht sich die abduktive Selektion und Konstruktion von Hypothesen sowohl auf das entdeckende Herausfinden von etwas, im Sinne der "detection", als auch auf die "invention" (vgl. CP 2.430). Das abduktive "Erfinden einer plausiblen Erklärung" ist die Basis sowohl des wissenschaftlichen als auch des detektivischen Denkens. Die Abduktion schließt von einer gegebenen Wirkung auf eine hypothetische Ursache zurück. Sie dient der Identifikation von Spuren, dem Ergänzen von Fragmenten, der Information über Ursachen und dem Erschließen der Intentionen und Gesetzmäßigkeiten eines Diskurses oder Tatsachenkomplexes. Voraussetzung für das Gelingen einer Abduktion ist ein detektivischer Spürsinn fürs Relevante, ein "Rate-Instinkt", der, einer Kompaßnadel gleich, bei der Selektion von möglichen Hypothesen in die richtige Richtung weist. Der abduktive Schluß integriert Assoziationen in argumentative Begründungszusammenhänge. Das bloße Raten wird zur Inferenz. Die gleiche Fähigkeit zum intelligenten Raten muß der Leser von Internet-Literatur besitzen. Er übernimmt die Rolle eines abduzierenden Detektivs, der die Spuren des Hypertextes liest, den Links folgt und einen plausiblen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Textfragmenten herstellt. Anstatt nur den vorgegeben Links zu folgen, muß der Leser-Detektiv auch die "missing links" suchen und finden. Er darf nicht der expliziten Link-struktur des Hypertextes vertrauen, sondern muß mit detektivischem Spürsinn die verborgenen Verbindungen und diskursiven Strategien entschlüsseln und abduktiv Mutmaßungen über den "Topic", den thematischen Zusammenhang aufstellen (vgl. Eco 1987a: 111f). Die Abduktion projiziert auf die labyrinthisch-rhizomatischen Verschlingungen unseres enzyklopädischen Weltwissens eine provisorische, im wahrsten Sinne des Wortes hypothetische "Ordnung der Dinge". Ohne ein limitierendes Relevanzkriterium führt die Freiheit, den rhizomatischen Raum, d.h. den Raum der Mutmaßung, auszschreiten in die "semantische Orientierungslosigkeit", mithin zu einer beliebigen Ordnung der Dinge und zur universellen Anschließbarkeit von allem mit jedem. Das Gestrüpp der vernetzten und verlinkten Querverweise entspräche dann jenem Spiel, "bei dem man durch Assoziation in fünf Schritten von Würstchen zu Platon gelangen soll" (Eco 1989: 264). Man stellt sprunghafte Kontiguitäts- und Assoziationsbeziehungen her und gelangt so von "Würstchen" zu "Schwein", von "Schwein" zu "Borste", von "Borste" zu "Pinsel", von "Pinsel" zu "Manierismus", von "Manierismus" zu "Idee" und von dort zu "Plato". Das Prinzip der universellen Anschließbarkeit karnevalisiert alle pragmatischen Relevanzsysteme. Es stellt willkürlich Kohärenzbeziehungen her und verwischt die Grenze zwischen relevanten und irrelevanten Aspekten. "Zusammenhänge gibt es immer, man muß sie nur finden" (Eco 1989: 264f). Angesichts dieses ungehemmten "Willens zur Verknüpfung" degeneriert die abduktive Detektivlogik in eine rein assoziative Aufpfropfung auf neue Kontexte. Nur wenn das assoziative, hypertextuelle Lesen aktiv in den Prozeß des abduktiven Hypothesenaufstellens integriert ist, wird die rhizomatische Verweisstruktur des Netzes zu einem "produktiven Feld", in dem sich "Entdeckungen, Erfindungen und Innovationen abspielen" (Idensen 1996: 149). Dies setzt allerdings voraus, daß, anders als Idensen behauptet, "das Denken selbst" nicht darauf reduziert wird "sich in den Zwischenräumen, im Übergang von einem Gebiet in ein anderes" zu ereignen (Idensen 1996: 149). Die Frage ist, ob damit die Zwischenräume im Hypertext oder die Übergänge zwischen Hypothesen über den Hypertext gemeint sind. Das Denken muß nicht bloß assoziativ sondern auch argumentativ anschließbar sein. Erst durch geistige Interaktion werden Anschluß- und Schnittstellen informativ und interessant. Insofern geht das abduktive Aufstellen von Hypothesen über das bloße assoziative, ratende Zusammenlesen von verlinkten Textfragmenten hinaus. Der Leserdetektiv muß auf seine abduktive Kompetenz zurückgreifen. III. Glaubt man Eco, so will ein "guter" Text "für seinen Leser zu einem Erlebnis der Selbstveränderung werden" (Eco 1984: 59). Die Frage ist, in welche Richtung sich der Leser verändert. Wird er vom sinnsuchenden Detektiv zum surfenden Dandy - oder umgekehrt, vom Dandy zum Detektiv - dies wäre ein nachgerade aufklärerisches Lektüreerlebnis. Wie auch immer. Der Hyper-Leser sollte die Fähigkeit erlangen, einen Perspektivenwechsel zwischen beiden Rollen zu vollziehen. Diese Aufforderung zum Umschalten ist ein Appell die manuelle "Klickability" in eine geistige "Switchability" zu transformieren. Das Erlebnis der Selbstveränderung ist der Höhepunkt jener lesergesteuerten Aktivitäten, die der Leser während seiner Lektüre vollzieht, nämlich eine, wenn auch nur kontingente, Kohärenz zwischen den hypertextuellen Schnipseln und Verweisen herzustellen. Dabei ist eine starke Analogie zwischen Ecos und Isers Theorie der interpretativen Kooperation und gegenwärtigen Hypertexttheorien festzustellen. Auch der Hypertext ist ein Produkt, "dessen Interpretation Bestandteil des eigentlichen Mechanismus seiner Erzeugung sein muß" (Eco 1987a: 66). In diesem Sinne braucht er einen Interpreten, der ihm dazu verhilft, zu funktionieren. Auch der Hypertext ist eine "Präsuppositionsmaschine" (Eco 1987a: 29), er lebt von einem "Mehrwert an Sinn", den der Empfänger erwirtschaftet, wenn er Leerstellen ergänzt und interpretiert. Die Leerstellen sind, mit Iser zu sprechen, "Appelle" an den Leser, aktiv zu werden. Sie sind "Gelenke des Textes", "Scharniere" der Darstellungsperspektive und erweisen sich dadurch als konstitutive Bedingungen der "Anschließbarkeit" (vgl. Iser 1984: 284). Sie gleichen in dieser Hinsicht den Links im Hypertext. Nach Iser kommt der Anschließbarkeit eine fundamentale Rolle bei der Textbildung zu, weil sich während der Lektüre "Geflecht möglicher Verbindungen" ergibt, "deren Reiz darin besteht, daß nun der Leser die unausformulierten Anschlüsse selbst herzustellen beginnt." (Iser 1984: 297). Der Leser wird dabei aufgefordert, abduktiv Hypothesen aufzustellen, um Selektions- und Kombinationsmöglichkeiten auszuprobieren. Die "kohärenzstiftende Funktion des Autors", wie sie Foucault in "Was ist ein Autor?" beschreibt, verliert in dem Maße an Relevanz, in dem der Leser als CoAutor fungiert. Literatur im Internet nimmt häufig die Form eines "Kollektivromans" an, so im Fall des Projekts Larissa des Süddeutschen Rundfunks, einem Kriminalroman, dessen Fortgang aktiv durch die Leser bestimmt wird, aber auch bei dem Internet-Roman Spielzeugland. Auch hier ist der Leser aufgefordert, Kommentare, Ideen und Assoziationen in den Textcorpus einzufügen. Diese Formen diskursiver Mitarbeit sind konstitutiv für die Poetik der Literatur im Internet. An die Stelle des anonymen "Murmeln des Diskurses" tritt das mediale "Fummeln am Hypertext". Kehren wir noch einmal zurück zum Spielzeugland: "Hier kann sich jedeR nach Lust und Laune mit eingescannten Fotos, Zeichnungen, Videosequenzen, selbstgemachten Tonaufnahmen und vor allem Geschriebenem austoben und den Hypertext bereichern. Wir werden den Text monatlich neu editieren, mit allen Ergänzungen, Veränderungsvorschlägen, Erweiterungen, Nebengeschichten und -schauplätzen etc., die du uns schickst. Du selbst kannst bestimmen, wo und wie dein Beitrag erscheinen soll - als Einschub oder als Fortsetzung, mit Link oder ohne. Hinter einem Link können sich genausogut Fotos, Zitate, andere Sichtweisen auf die Handlung, Querverweise, o.ä. verbergen." Dennoch gibt es auch hier noch eine übergeordnete Instanz, die entscheidet, wer an welcher Stelle des Hypertextes spricht. Diese zentrale Funktion des Autors wird vom Herausgeber übernommen. "Sei nicht enttäuscht, wenn etwas nicht sofort oder nicht ganz wortgetreu erscheint. Wir möchten uns die redaktionelle Arbeit an den Texten, die uns über e-mail geschickt werden können, vorbehalten, um eine gewisse Stringenz der Gesamtnovelle zu gewährleisten". Der Herausgeber von Literatur im Internet steht in einem Spannungsverhältnis, das sich als Pendeln zwischen zwei extremen Polen beschreiben läßt. Auf der einen Seite die interne Kohärenz des Textes. Auf der anderen Seite die Freiheit des Lesers, der zugleich CoAutor ist und so durch sein individuelles Zusammenlesen Kohärenz stiftet. Die Frage nach dem Autor transformiert sich in die Frage nach einer überpersönlichen Autor- bzw. Herausgeberstrategie, die den Hypertext organisiert. Ohne eine solche diskursive Ordnung ist der Hypertext ein wirres Geflecht, das man nicht interpretieren kann. Im 97. Kapitel von Cortázars Roman Rayuela, der vielen Autoren und Theoretikern - neben Borges - als Vordenker hypertextuell organisierter Literatur im Internet gilt, wird eine Notiz Morellis erwähnt, in der dieser von einer absurden und inkohärenten Form des Schreibens träumt, die dementsprechend einen Leser verlangt, der in der Lage ist, mit dieser Inkohärenz fertig zu werden. "Diesem Leser wird jede Brücke fehlen, jedes Zwischenglied, jede kausale Verbindung. Die Dinge im Rohzustand: Verhaltensweisen, Resultate, Brüche, Katastrophen, Lächerlichkeiten" (Coráztar 1987: 498). Eco betont, daß "lebendige Kunstwerke" offen für neue interpretative und kommunikative Möglichkeiten sein sollen. Anders als für Derrida ist für ihn der Interpretationsprozeß keine führungslose Abdrift, sondern gleicht einer Pendelbewegung zwischen der "Offenheit" der Rezeptionsmöglichkeiten und der "Geschlossenheit" bzw. Bestimmtheit des Werkes durch seine Struktur. Die Aufgabe der Interpretation eines ästhetischen Textes ist es, "das strukturierte Modell für einen unstrukturierten Prozeß eines kommunikativen Wechselspiels" zu liefern" (Eco 1987b: 367). Dabei ist die "interne Kohärenz des Textes", also seine diskursive Organisation der wichtigste Parameter für seine Interpretation (Eco 1992: 46). Da die Kohärenz des Textes jedoch erst durch die abduktive Mitarbeit des Interpreten konstituiert wird, ist die Textkohärenz unauflöslich mit der "Konsistenz der Hypothesen über den Text" verbunden. Ob man einen Text interpretiert oder ob man ihn bloß gebraucht, hängt davon ab, in welchem Maße man die "interne Kohärenz" respektiert und ob die Hypothesen über den Text so formuliert sind, daß man sie kritisch hinterfragen kann. Zwar gibt es nicht "die eine", "einzig richtige" Interpretation, wohl aber nachweislich falsche. In dem Maße, in dem Hypertexte auf eine Struktur, bzw auf eine interne Kohärenz verzichten, um sich ganz den Entscheidungen des Lesers zu öffnen, verwischt die Grenze zwischen Interpretation und Gebrauch. Ein total offener Hypertext ist daher völlig uninterpretierbar. Generell lassen sich zwei Formen von "Offenen Texten" vorstellen. Ecos Beispiele für "offene Texte" sind solche, die "plurale Lektüren" ermöglichen, wobei es sich aber immer um den in syntaktischer Hinsicht selben Text handelt. Verschiedene Leser bewegen sich auf demselben syntaktischen Pfad, doch sie ergänzen die diskursiven Leerstellen, indem sie verschiedene semantische Paradigma "einlesen". Dabei haben die diskursiven Leerstellen auch eine argumentative Funktion. Bei der hypertextuellen Offenheit präsentiert sich ein anderes Bild: Die Textstruktur ist das Ergebnis eines assoziativen Zusammenlesens. Zwei Leser stellen sich syntaktisch verschiedene Texte zusammen. Insofern scheint der Lektüre eines offenen Hypertextes die zentrale Forderung des dekonstruktiven Lesekonzepts strukturell "eingeschrieben" zu sein (nämlich als Programm): Die Freiheit des Lesers sich "seinen" Text zusammenzustellen, indem er bestimmten Links folgt, um dann, ebenso willkürlich, einen Lektürepfad wieder zu verlassen und zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Die "Autorität der Sequentialität", die dem Leser einen linearen Lesepfad vorschreibt, scheint gebrochen. Desgleichen der Zwang zu einer konsistenten Interpretation. Da es keinen kohärenten Text vor der Lektüre gibt, sondern dieser erst ad hoc, durch Leserentscheidungen entsteht, kann der Text auch inkonsistent bleiben. Damit ermöglicht der Hypertext eine Lektürehaltung, die de Mans Vorstellungen entspricht, denn Dekonstruktion ist für ihn "die Möglichkeit, die Widersprüche der Lektüre in eine Erzählung einzuschließen, die fähig wäre, sie zu ertragen" (de Man 1988: 105). Der Hypertext kann aufgrund seiner Organisationsform Ereignisse auf anschauliche Weise polyperspektivisch schildern. Doch gerade wegen seiner Netzstruktur wird es schwierig Entwicklungen zu schildern und beim Leser Spannung zu erzeugen. Da der narrative Fluß fehlt, ist für das Gelingen die Strategie der Fragmentierung der Textteile ausschlaggebend. Wechselt diese Strategie auf undruchsichtige Weise oder werden Zusammenhänge auf Dauer versteckt, kommt es zu einer interpretativen Desorientierung, die mitunter das Gefühl des "lost im hyperspace" hervorruft. Dem Leser vergeht die Lust am Hypertext, wenn die diskursiven Sprünge und Widersrpüche nicht mehr interpretativ nachzuvollziehen sind. Michael Joyce beschreibt in den Hinweisen für die Leser seines Internet-Romans Afternoon das Dilemma hypertextueller Strukturen: Gerade die leserorientierte Offenheit der Hypertexte ist auch der mögliche Grund für ihre Langeweile. Denn "wenn eine Geschichte nicht vorangeht, oder wenn sie zyklisch wird, oder wenn man müde wird, einem Pfad zu folgen, dann kommt das Leseerlebnis zu einem Ende". Der hypertextuellen Offenheit liegt die dekonstruktivistische Idee
der aufpfropfenden Rekontextualisierung von Textabschnitten, Fragmenten
und Schnipseln zugrunde. An die Stelle der Idee der "infiniten Semiose"
als Kette von Argumenten tritt bei Derrida die unendliche Kette der
assoziativen Iterationen eines Zeichens in Form rekontextualisierender
"Aufpfropfungen". Das Fehlen eines "absoluten Verankerungszentrums"
(Derrida 1976: 141), ist der Grund für die "wesentliche Führungslosigkeit"
des Lese- und Verstehensprozesses (Derrida 1976: 135). Die Links dienen
dazu, mögliche Kontexte zu determinieren. Und diese Operation des
Determinierens von Kontexten ist, wie Derrida in seinem Afterword
zur amerikansichen Ausgabe von limited inc bemerkt, immer etwas
Politisches (Derrida 1988: 136). Das politische Moment der diskursiven
Praxis findet man einmal auf Seiten der Autoren und Herausgeber, wenn
sie einen Link an einer bestimmten Stelle setzen und an einer anderes
Stelle nicht. Man findet das es aber auch auf Seiten des Lesers, wenn
er einem bestimmten Link folgt aber einen anderen außer acht läßt.
Im Gegensatz zur Peirceschen Abduktion transformiert die rekontextualisierende
Bewegung der Aufpfropfung eine Assoziation in eine weitere Assoziation.
Jedes Lesen wird zum unüberprüfbaren "Fehllesen". Die entscheidende
Frage ist daher, ob der "Text in Bewegung" eine aufpfropfende oder eine
abduktive Logik des Lesens erfordert. Der Unterschied zwischen beiden
Formen "offener Texte" betrifft die vom Text geforderte Rolle des Lesers.
Einmal ist er sinnsuchender Detektiv, das andere Mal surfender Dandy.
Erst wenn eine Interaktion zwischen beiden Rollen stattfindet, werden
"Kurzschlüsse und Interferenzen zwischen Diskursen" (Idensen 1996:
149) zu produktiven Feldern, kann das "Netzwerk von selbst gestaltbaren
Ideen- und Daten-Assoziationen" kreativ genutzt werden (Idensen 1996:
150). IV. Damit haben wir eine vorläufige Antwort auf unsere Frage nach der Rolle des Lesers im Kontext der Internet-Literatur gefunden. Der Leser ist immer noch Detektiv, doch er ist weniger Sherlock Holmes, denn Don Isidro Parodi. Parodi ist der Held der Detektivgeschichten von Borges, die eine "karnevaleske Welt" des detektivischen Schlußfolgerns beschreiben. Parodi löst seine Fälle von der Gefängniszelle Nr. 273 aus, in der er sitzt, weil er angeblich einen Metzger umgebracht hat. Doch diese ungünstige Ausgangsposition beeinträchtigt Parodis detektivische Arbeit in keiner Weise. Er findet seine Spuren und Indizien in den geschwätzigen Erzählungen seiner Klienten, die ihn völlig unbehindert und "in pittoresker Fülle" besuchen. Man fragt sich, warum Parodi ausgerechnet jene Information herausgreift, die ganz offensichtlich irrelevant sind. Seine instinktive Wahl bei der Auswahl von Informationen ist rational nicht nachvollziehbar. Betrachten wir dies als Metapher für die Situation des Lesers-Detektivs von Internet-Literatur, der in seiner dunklen Kammer sitzt. Und fragen wir noch einmal: Was muß er können und wissen, um Internet-Literatur rezipieren zu können? Als guter Leser-Detektiv wird er seine abduktive Kompetenz als geistigen Kompaß im rhizomatischen Labyrinth des Diskurses nutzen. Doch er muß auch seine abduktive Kompetenz, welche immer schon auf "vorausgelegte" Relevanzstrukturen und Kohärenzerwartungen zurückgreift, ironisch reflektieren können, ja sie womöglich "auf den Kopf stellen". Springen wir noch einmal zu Borges. Um im Universum irrelevanter Geschwätzigeit lesen zu können, braucht Parodi, wie Eco in seinem Aufsatz Die Abduktion in Uqbar ausführt, eine Eigenschaft, die diese Erzählungen zu "ironischen Spiegelbildern" richtiger Detektivgeschichten macht: einen Spürsinn fürs Irrelevante und Inkohärente (vgl. Eco 1988: 213). Seine Abduktionen und Konjekturen gelingen, weil die Unordnung und Zusammenhanglosigkeit seiner Ideen mit der Unordnung und Zusammenhanglosigkeit der Dinge koinzidiert. Anders als viele Internetpropheten, die in der rhizomatischen Struktur eine Befreiung vom hierarchischen Denken sehen, scheint bei Borges eine skeptische Sicht zu überwiegen. Für ihn ist die rhizomatische Bibliothek keine Metapher, die man Aufgrund technischer Neuentwicklungen wörtlich nehmen kann. Die rhizomatische Bibliothek repräsentiert die traurige Realität unseres Denkens, eine Landkarte des Bewußtseins sozusagen: "Die Ruchlosen behaupten, daß in der Bibliothek die Sinnlosigkeit normal ist, und daß das Vernunftgemäße (ja selbst das schlecht und recht Zusammenhängende) eine fast wundersame Ausnahme bildet. Sie sprechen (ich weiß es) von der ´fiebernden Bibliothek, deren Zufallsbände ständig in Gefahr schweben, sich in andere zu verwandeln und die alles behaupten, leugnen und durcheinanderwerfen wie eine delirierende Gottheit´" (Borges, 61f.). Nicht das Wissen selbst, sondern das Erkennen seiner labyrinthischen
Organisationformen ist strukturell gesehen das wertvollste Wissen, das
die Bibliothek repräsentiert. Ihre Struktur ist ihre Botschaft
und erfüllt dergestalt eine poetische Funktion im Sinne Jakobsons.
Zugleich zeigt sich hier eine Analogie zu McLuhans Schlagwort, daß
das Medium die Botschaft ist. Das gleiche gilt für die hypertextextuell
organisierte Literatur im Internet. Bolter, Jay David (1991), Writing Space. Computer, Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale. Borges, Jorge Luis (1986), "Die Bibliothek von Babel". In: Die zwei Labyrinthe. München: dtv: 54-63. Calvino, Italo (1983), Wenn ein Reisender in einer Winternacht. München: dtv. Cortazár, Julio (1987), Rayuela. Himmel und Hölle. Frankfurt: Suhrkamp. de Man, Paul (1988), Allegorien des Lesens. Frankfurt: Suhrkamp. Derrida, Jacques (1976), "Signatur Ereignis Kontext". In: Randgänge der Philosophie. Frankfurt, Berlin, Wien: Ullstein: 124-155. Derrida, Jacques (1988), "Afterword: Towards an Ethic of Discussion". In: Limited Inc. Evanston: North Western University Press: 111-154. Eco, Umberto (1977), Das offene Kunstwerk. Frankfurt: Suhrkamp. Eco, Umberto (1980), Der Name der Rose. München: Hanser. Eco, Umberto (1984), Nachschrift zum 'Namen der Rose'. München: Hanser. Eco, Umberto (1985), Semiotik und Philosophie der Sprache. München: Fink. Eco, Umberto (1987a), Lector in fabula. München: Hanser. Eco, Umberto (1987b), Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen. München: Fink. Eco, Umberto (1987c), Der Streit der Interpretationen. Konstanz: Konstanzer Universitätsreden. Eco, Umberto (1988), "Die Abduktion in Uqbar". In: Über Spiegel und andere Phänomene. München: Hanser: 200-213. Eco, Umberto (1989), Das Foucaultsche Pendel. München: Hanser. Eco, Umberto (1992), Die Grenzen der Interpretation. München: Hanser. Flusser, Vilém (1987), Die Schrift. Hat Schreiben Zukunft? Göttingen: Immatrix. Idensen, Heiko (1996), "Die Poesie soll von allen gemacht werden". In: Literatur im Informationszeitalter. Herausgegeben von Dirk Matejovski und Friedrich Kittler. Frankfurt / New York: Campus: 143-184. Iser, Wolfgang (1984), Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. (zweite, verbesserte Auflage) München: Fink (UTB). McLuhan, Marshall (1968), Die Gutenberg-Galaxis. Das Ende des Buchzeitalters. Düssledorf / Wien: Econ. Peirce, Charles Sanders, (CP) Collected Papers. Band I-VI. Herausgegeben von Charles Hartshorne und Paul Weiß. Harvard University Press 1931-1935. Band VII, VIII. Herausgegeben von Arthur W. Burks. 1958. Proust, Marcel (1957), Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Band 13. Die wiedergefundene Zeit. Frankfurt: Suhrkamp. Schlegel, Friedrich (1962), Lucinde, Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Band V. Hrsg. von E. Behler, H. Eichner. München, Paderborn, Wien: Schöningh. Wingert, Bernd (1995), "Die neue Lust am Lesen? Erfahrungen und Überlegungen zur Lesbarkeit von Hypertexten." In: Kursbuch Neue Medien. Mannheim: Bollmann. Wingert, Bernd (1996), "Kann man Hypertexte lesen?"
Original-URL: http://www.rz.uni-frankfurt.de/~wirth/texte/litim.htm |