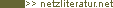
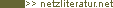 |
|
Performanz und Rollenspiele von
Beat Suter
Performanz Komma Dampf
Zwei Wochen vor dem Symposium InterSzene in Romainmôtier saßen Susanne Berkenheger und ich als einzige Vertreter der "Netzliteraturszene” an einem andern Kolloquium in den Schweizer Bergen, das über Performanz in der Literatur diskutieren sollte. Als Teil des stimmungsvollen Literaturfestivals "Würfelwort Komma Dampf” hatte das Institut für Theorie der Hochschule für Gestaltung Zürich mit Jörg Huber und Sibylle Omlin in Leukerbad zwei Veranstaltungen zum Thema "Inkarnation – Animation – Exkarnation” organisiert. Der Teilnehmerkreis des Kolloquiums war mit Friederike Kretzen, Thomas Hettche, Harald Taglinger, Elisabeth Wandeler-Deck, Gerhard Jaschke, Thomas Kapielski, Ulf Poschardt, Bernd Rauschebach und Jörg W. Gronius ziemlich bunt zusammengewürfelt. Die "Vertreter der alten und der neuen Performanz”, wie die NZZ darauf treffend schrieb, fanden keinen gemeinsamen Nenner und kamen nicht umhin, gegenseitig etwas Dampf abzulassen. Kein Wunder, denn die Kernfragen in Bezug auf Internet und Literatur lauteten auch "Wird im Computer nicht alles zum Gimmick? Verflacht nicht jeder Konflikt zum Maus- und Herausklick, bleiben interaktive Figurenspiele nicht stereotyp, wo bleibt die Spannung der Literatur?” Einmal mehr zeigte sich in Leukerbad, wie schwierig die Vermittlung von Hyperfiction, bzw. von internetbasierter Literatur an Veranstaltungen ist – und dies selbst bei einem Publikum, das ein offenes Ohr und eine rechte Portion Neugier mitbringt. Denn diese positiven Aspekte sind meist gepaart mit wenig Kenntnissen des neuen Mediums. Die Zuhörer bringen daher meist auch wenig Verständnis für die unterschiedlichen Ausdrucks- und Darstellungsformen sowie den experimentellen Charakter der fremdartig anmutenden Projekte auf. Die "Vertreter der alten und der neuen Performanz” waren ziemlich ungleich verteilt. Unter den neun teilnehmenden Literaten fand sich mit Susanne Berkenheger gerade einmal eine Autorin, die Hyperfictions herstellt. Ein weiterer, Harald Taglinger, beschäftigt sich wenigstens mit Online-Design und Online-Typografie. Sein Projekt "Klik!”, ein visueller Essay, wurde separat ausgestellt, Taglinger blieb es also erspart, sein Projekt dem Kolloquiumspublikum vorführen zu müssen. Die traditionellen Autoren überwogen, bekräftigten sich gegenseitig in ihrer Argumentation und fanden auch noch eine auf sie zugeschnittene Präsentationssituation vor. Besonders die klassischen Sprachspieler konnten da brillieren: Bernd Rauschebach und Jörg W. Gronius begeisterten das Publikum sofort mit ihrem performativen Auftritt, in welchem sie ihre Sprachspiele und Textklaubereien wirkungsvoll vortrugen, intonierten, sangen, summten, flüsterten, schrien. Das Publikum selbstverständlich war sofort von ihrem Vortrag gefangen. Die inszenatorische Wirkung von Rauschebauch und Gronius sowie die Belanglosigkeit der Video Vorführung von Elisabeth Wandeler-Deck vernebelte offensichtlich auch ein wenig den Blick, denn sogleich wurde bei der folgenden Diskussion die Oberflächlichkeit und Risikolosigkeit der einzigen gezeigten Hyperfiction von Susanne Berkenheger bemängelt. Da spielte es denn offenbar keine Rolle, dass damit wohl vor allem die Vermittlung über die Oberfläche des Bildschirms gemeint sein musste, denn der eigentliche Text der Hyperfiction ist erzählerisch und dialogisch alles andere als oberflächlich und sowohl formal als auch inhaltlich sowie in der Präsentation mit der Funkmaus, die ins Publikum gegeben wird, nicht gerade frei jeglichen Risikos. Dies wird besonders auch in der direkten Konfrontation mit den Sprachspielereien von Rauschebach und Gronius klar, die in ihren Texten vor allem auf Bewährtes zurückgreifen und mit ihrem sorgfältig abgestimmten Vortrag ganz bestimmte Effekte im anwesenden Publikum erzielen und erreichen – und somit einerseits ganz gut von der Oberflächlichkeit der Texte leben und andererseits gut davon abzulenken vermögen. Wohl gemerkt: Diese Texte stimmen so, wie sie sind. Sie vermögen zu gefallen. Doch es leuchtet nicht ein, weshalb anderen Autoren Oberflächlichkeit und Riskolosigkeit vorgeworfen wird, während die eigenen Texte ja genau – durchaus virtuos – mit Oberflächenspielereien arbeiten. Diese Strategie der Distanzierung, Klischeeisierung und Verschleierung jedoch ist symptomatisch für Veranstaltungen zur Vermittlung von Hyperfiction: Das Publikum und meist auch die traditionellen Autoren halten sich mit dem vermittelnden Medium auf, weil sie noch immer nicht damit zurecht kommen, und vergessen völlig, darauf zu schauen, was die Texte wirklich sagen.
"Alte” und "neue” Performanz
Die in Leukerbad vorgetragenen und vorgestellten Projekte konnten hinsichtlich des Aspektes der Performanz denn unterschiedlicher nicht sein. Bei Hyperfictions kommt eine ganz andere Art von Performanz zu tragen als bei den Sprachspielen von Rauschebach und Gronius, Jaschke und anderer. Bei jenen geht es in erster Linie um die Performance des Autors bzw. um eine Literaturinszenierung auf der Lesebühne durch den Autor oder gar einen Regisseur. In Hyperfictions jedoch geht es um eine Performanz des Lesers oder Rezipienten. Der Leser wird vom Autor ins Stück miteinbezogen und kann eine mehr oder weniger aktive Rolle annehmen. Auf dem Theater ist dieser Umstand selbstverständlich nichts neues, in einer Literaturinszenierung auch nicht, in der 1:1-Beziehung zwischen Text und Leser schon eher. Denn die Beteiligung des Lesers an einem Text spielt sich normalerweise im eigenen Kopf ab. Man liest und imaginiert das Gelesene und knüpft dabei die Fäden im eigenen Kopf zusammen. Der Hyperfiction-Leser dagegen muss seine Rolle wahrnehmen – und sei dies auch nur über die Entscheidung einen Link anzuwählen und den andern sein zu lassen – denn wenn er nichts tut, entwickelt sich auch keine Story. Das heisst aber, dass der Prozess des Imaginierens in Hyperfictions externalisiert wird. Diese These der Externalisierung des Imaginären wurde auch von Michael Böhler am Fachkongress Elektronisches Publizieren in München (27. Mai 2000) vertreten (vgl. Böhlers Thesen im Forum von IASL und dichtung-digital). Aus dem Imaginären im Kopf entsteht ein virtueller Raum, in dem der Leser mehr oder weniger eingeschränkt – je nach Hyperfiction – entscheiden und handeln, ja manchmal sogar konkret mitschreiben kann. Der Leser wird also zumindest zum Mit-Arbeiter am Text. Zwar ist auch das Lesen und Interpretieren eines Buchromans immer ein nicht zu unterschätzendes Stück Arbeit und Mitarbeit – dies soll überhaupt nicht in Abrede gestellt werden –, das Neue an vielen Hyperfictions ist jedoch die Möglichkeit, diese Mit-Arbeit ganz konkret in einem eigens dafür konstruierten bzw. fingierten Raum leisten zu können. Am besten lässt sich dieses Prinzip
an jenen Abenteuer- und Simulationsspielen zeigen, die mit teils
althergebrachten Erzählmustern und einer immersiven Umgebung
arbeiten. Als Beispiel kann das Spiel Riven gelten. Wer Riven
spielt, wird unweigerlich in die Geschichte hineingesogen bzw. vollständig
hineingezogen. Er befindet sich als Ich-Person – die Welt wird
aus der Perspektive einer Person wahrgenommen, die der Spieler als
"ich” identifiziert – in einer neuen Umgebung, einer simulierten
Weltumgebung, in Falle Rivens einer Inselwelt mit diversen
unbekannten und geheimnisvollen Inseln, die über seltsame Transportsysteme
miteinander verbunden sind. Der Spieler kann sich nun als Ich-Person,
die zu Anfang von Atrus direkt angesprochen wird und einen Auftrag
erhält, ganz realistisch durch diese Umgebung bewegen und mit
jedem Schritt die Geschichte beeinflussen, bzw. sie weiterführen
und prägen. Die Narration wird in Riven nicht mehr durch
Lesen und Interpretieren vollzogen, sondern durch das Navigieren,
bzw. durch das konkrete Beschreiten eines Pfades in einem virtuellen
Raum. Diese vollständige Immersion ist es, die auch andere
Hyperfictions auszeichnet: eine Immersion des Lesers in das Imaginäre,
das ihm ganz real in einer fingierten Welt oder Weltumgebung begegnet.
Scroll back, scroll forward, (Sc)Rollenspiele
Das Symposium "InterSzene” in Romainmôtier beschäftigte sich ebenfalls mit dem Thema Performanz und liess vermuten, dass dort einige Projekte zu sehen sein würden, die sich stark an der Lebenswelt orientieren, mit Dialogen arbeiten und sich an dramaturgischen Abläufen des Theaters und Films orientieren. Die Einladung wenigstens kündigte "Hör- und Schauspiele aus dem Netz” an und die Fragestellung, "ob sich künstlerisch-sprachliche Werke im Netz nicht besser aus dem Blickwinkel mündlicher Darstellungsweisen wie Hörspiel und Theater betrachten liessen als vom Standpunkt der Buchliteratur aus.” Meine Aufgabe sollte ein "Scroll back” am Ende des ersten Tages sein. Ein "Scroll back”? Den Rollbalken zurückrollen oder aufrollen? Gemeint ist der Rollbalken eines Internet-Browsers, Textverarbeitungs- oder eines andern Programms. Doch auch in der Computersprache wird ein "Scroll” lediglich mit "up” oder "down”, "right” oder "left” kombiniert. Das Wort "Scroll” allerdings wurde für den Computergebrauch lediglich adaptiert, es existiert im Englischen schon länger. Es ist erstmals im 15. Jahrhundert nachweisbar, damals noch als "scrowle”. Seine erste Bedeutung ist eine Papierrolle oder ein Pergament, meist mit etwas Geschriebenem darauf. Das Verb "scroll” taucht zum ersten Mal 1606 auf, und zwar in seiner transitiven Bedeutung: etwas auf eine Papierrolle niederschreiben. Die intransitive Bedeutung "etwas aufrollen oder zusammenrollen” ist erst für das Jahr 1868 belegt. Diese Bedeutung kommt dem "Scroll back” wohl am nächsten. Meine Aufgabe hätte also gelautet, sämtliche Vorträge und Diskussionen des ersten Symposiumstages vom zuletzt Gehörten zum zuerst Gehörten aufzurollen. Das wäre dann doch ein wenig aufwendig geworden, deshalb hatte ich mich genauso wie Beat Mazenauer auch lediglich auf zwei Aspekte konzentriert, die mir im Verlauf des Tages aufgefallen waren und die mich auch besonders interessierten: Diskursstrategien und das Thema Immersion. Womit ich wohl lückenlos an meinen Gedanken zum Kolloquium in Leukerbad anknüpfen kann. Diskutiert wurde in Romainmôtier viel und ausführlich, doch über Diskursstrategien geredet, wurde leider fast nicht. Trotzdem waren die Experimente in Rollenspielen diejenigen Aspekte am Symposium, die mich zu faszinieren vermochten. Das Projekt SM Services, das Gisela Müller vorstellte (siehe Müllers Beitrag), besticht durch seine konzeptuelle Einfachheit und die rigorose Beschränkung auf den Austausch von Botschaften mit höchstens 143 Zeichen. Es ging dabei um Kurztexte (SMS), die aus dem Ausstellungsraum im Münchner Rathaus an diverse Autoren irgendwo auf der Gasse geschickt werden konnten. Die Autoren antworteten, und die Texte wurden sofort in die Homepage eingelesen, wo sie vom Ausstellungspublikum gelesen werden konnten. Problematisch dabei erscheint mir die Verwendung von Autoren als Antwortlieferanten in der Rolle von Autoren, was sie ja in Wirklichkeit auch sind. Das schlägt sich denn auch in den Antworttexten nieder, die oft nicht besonders interessant wirken. Hätten ebendiese Autoren mit klaren Strategien gearbeitet, hätten sie bsp. fiktive Figuren gespielt, einer einen bekannten Fussballer, eine eine Politikerin, einer einen Pizzaboy etc., wäre das Resultat wohl auch textlich interessanter geworden. Aber offensichtlich erwartete man von den Autoren goldene Worte. Nur so lässt sich auch erklären, dass bei der Präsentation des Projektes im Internet und von Gisela Müller in Romainmôtier lediglich Antworten von Autoren zu sehen sind bzw. waren. Die dazugehörigen Fragen und Texte der Ausstellungsbesucher sind nicht mehr vorhanden. Dabei ist doch gerade dieses stark eingeschränkte, offene und flüchtige Projekt ganz auf den Dialog ausgerichtet, und man möchte zumindestens gern wissen, welche Strategien und Muster hier von Leser und Autor, die minimalistisch miteinander zu kommunizieren versuchen, verwendet werden. Rollenspielen in einer Live-Vorführung begegnete man dann in "Telefonieren zu vier Händen”, dem Chat-Event von Martina Kieninger, Susanne Berkenheger und zwei weiteren anonymen Chattern. Allerdings wurde auch hierbei ersichtlich, dass ein solches Rollenspiel per Chat eine ausführliche Vorbereitung und ein Auslegen der Spiel- und Diskursstrategien der Teilnehmenden benötigt. Die einzelnen Chat-Figuren zumindest müssten klarer aufeinander abgestimmt werden. Dies auch damit der einzelne Chatter sich einen eigenen Raum konstruieren kann, in dem er sich dann geschickt bewegen kann. Seinen virtuellen Raum konstruiert er sich nämlich – und das machte Tilman Sack als geübter Chatter klar – lediglich über den Dialog. Der Dialog ist das einzige kommunikative Mittel des Chats, und dieser geschieht mittels Text, mittels eines Austausches von schnell verfassten Texten. Die dramatische Form ergibt sich im Chat von selbst, der Teilnehmer muss sich keine Gedanken darüber machen. Diese Grundlage nutzte Tilman Sack für sein Chattheater "Kampf der Autoren". Er ließ vier Autoren einige Tage und Nächte chatten, fügte dem nichts hinzu, verschob nichts, sondern strich lediglich. Aus 250 Chat-Seiten wurden schließlich 38 Theaterseiten. Sein Produkt vermochte zu überzeugen, auch in Romainmôtier, wo es lediglich in ein paar Standbildern präsentiert werden konnte. Denn Tilman Sack wollte keine neue Form eines Internet-Theaters entwickeln, sondern die neuen Kommunikationssituationen im Netz für das Theater nutzbar machen. Mit der Einführung eines halbtransparenten Kobens auf der Bühne, der quasi eine zweite Realitätsebene generiert, und diversen Dialogüberlagerungen gelang ihm dies auf relativ einfache Weise, denn ohne dass es explizit gesagt wird, erfahren und erkennen die Zuschauer dadurch den virtuellen Raum und sehen sich gar darin integriert.
Immersion ist nicht nur wichtiger Bestandteil einer Hyperfiction, sondern die wichtigste Voraussetzung zur erfolgreichen Vermittlung einer Hyperfiction oder eines multimedialen literarischen Projektes. Dies zeigt sich an fast allen Veranstaltungen, an denen derartige Projekte präsentiert werden. So gelang denn die Präsentation von "Hilfe!” in Romainmôtier besser als in Leukerbad, weil das Publikum durchaus sehr vertraut war mit dem neuen Medium. Kein zögerlicher Einsatz der Funkmaus ließ Unbehagen aufkommen. Der Textwechsel war temporeich, und Tilmann Sack steuerte mit seinem schnellen und mehrfach repetitiven Anwählen bestimmter Fenster und Texte, die von Susanne Berkenheger gelesen wurden, eine neue Dimension hinzu. Trotzdem konnte auch diese Präsentation nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch immer etwas fehlt: der Aspekt des Immersiven. Die allererste Version von "Hilfe!” wurde am Symposium Digitaler Diskurs 1999 am gleichen Ort spontan vom Wiener Autor und Schauspieler Martin Auer (vor)gelesen. Damals war sofort klar geworden, dass eine professionelle Interpretation der Rollen den Zuhörer sofort näher an den Text heranführt. Die Autorin selbst hatte dann an einer Lesung in München versucht, den Text mit mehreren Schauspielern zu lesen, was eine weitere Dimension anfügte. Doch in den Text hinein führt eigentlich nur die 1:1-Situation von Leser und Text am Bildschirm. Denn erst mit der Identifikation einer klaren Rolle begibt sich der Leser in den virtuellen Raum hinein und wird Teil der Fiktion. Erst damit kann er die immersive Position einnehmen, die die Geschichte eigentlich verlangt. Die Hörspielvariante von "Hilfe!”,
die Uwe Wirth für den Hessischen Rundfunk entwickelt hatte,
ließ ausser acht, was Tilman Sack in seinem Chattheater bewusst
eingesetzt hatte: den Einbau einer zweiten Ebene, welche die Ebene
der Narration bricht und damit von der neuen Form der Kommunikation
bzw. von der Form des literarischen Werks erzählt. Die Strategie,
sich am Text zu orientieren und ihn auszubessern, hat wenig gebracht.
Dabei ließe sich auf relativ einfache Weise eine neue, eine
Meta-Ebene einführen. Beispielsweise indem man die Situation
des Vortragens von "Hilfe!” thematisiert. Man nehme dazu vier
Schauspieler und lasse sie die einzelnen Rollen von Ed, Lea, Max
und Pia sprechen. Und zwar in der Situation einer Probe: Der eine
beschwert sich über den seltsamen Text "Was soll das?”
Dem andern ist seine Rolle zu langweilig, die dritte hat eine Verabredung,
möchte die Probe schnell abschließen und fühlt sich
genervt über die dauernden Unterbrüche und Wiederholungen
etc. So könnte die Hyperfiction im Hörspiel mediengerecht
gebrochen und dem Hörer damit die Situation der Geschichte
bewusst gemacht werden. InterSzene: Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Um Arbeiten und Projekte, die "Unterschiede, Übergänge und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Medien zeigen”, ging es allgemein am Symposium. Doch oft genug wurden Unterschiede hervorgehoben anstatt Gemeinsamkeiten. Chatexperimente und Hypertextfiction haben für Stephan Porombka längst ausgedient. An ihre Stelle soll bsp. "das kleine Mädchen mit dem Flammenwerfer” von Tim Staffels treten. Dieses Werk stellt für Stephan Porombka eine neue Art von "multimedialer Literatur” dar, die nicht nur übersetzt und umgesetzt, sondern gezielt medial verwandelt wird. Dabei müssen die Produzenten nach Reduktion der Komplexität und Interaktivität streben, bzw. "das Interaktivitätsdogma soll gebrochen werden”. In den videonahen Sequenzen brennt das herumstapfende (Strich)Mädchen mit seinem Flammenwerfer indifferent alles nieder, die Augen leuchten teuflisch. Nach dem Betrachten des Projekts stellt sich die Frage, ob eine solche Art von Textverwandlung denn mehr hervorbringen kann als ein simples Horrorvideomärchen mit mangelhafter Interaktivität? Hermann Rothermund gar macht einen weiteren Schritt zurück in frührere Jahrhunderte und setzt sich für eine Cyberoper ein: die Silesius-Diskette, ein Stück Multimedia-Literatur nach Motiven von William Gibsons "Neuromancer”. Immerhin ein bisschen "(inter)aktives” Sampeln auf dem Beatnik Player wird für den Betrachter des teutonischen Hochkultur-Projektes dereinst auch noch drin sein, wenn vielleicht eine Uraufführung in Bayreuth stattfindet. Beide Projekte beanspruchen für sich, neue Formen elektronischer Literatur zu entwerfen, indem sie alte Kunstformen ins neue Medium übertragen, und sie haben dabei vor allem mit Unschärfen zu kämpfen, die beim Versuch der Kreation neuer Formen unvermeidbar sind. Die beiden Projekte stehen denn auch dem Chattheater von Tilman Sack diametral gegenüber, der genau das Gegenteil macht, die neuen Kommunikationsformen ausführlich studiert und sie für die die altbewährte Disziplin des Theaters erfahren und innovativ zu nutzen weiss. Der einzige, der den Leser bzw. Hörer in seinen Projekten ohne Vorbehalte zum Autor gemacht hatte, war Detlef Clas vom SWR. Er präsentierte verschiedene Projekte, so unter anderen die Experimente um Larissa42, die bereits 1995 beim SDR begonnen hatten (siehe Clas' Beitag). Beim interaktiven Hörspielkrimi, der durch die Weiten des Alls und die Niederungen menschlicher Beziehungen führte, erstellten die Leser in einer redaktionell geführten Kooperation den narrativen Bogen. Durch die Beteiligung vieler Leser entstanden komplexe Handlungsabläufe und sehr viele Brüche. Das Hörstück war schwierig zu kontrollieren, aber sehr erfolgreich bei den Hörern und äusserst beliebt bei jenen Hörern, die zu Autoren mutiert hatten. Äusserst interessant war auch
die Präsentation der Arbeit von Walter Grond, Martin Krusche
und Klaus Zeyringer. Es handelt sich beim Projekt "house”
mit Untertitel "ein projekt über das fremde” zwar nicht
um Hyperfiction oder formal neue Netzliteratur, sondern im Prinzip
lediglich um elektronisch aufbereitet Texte, die teils weiter vernetzt
sind. Diese aber haben es in zweifacher Hinsicht in sich: einerseits
sind sie alle politisch motiviert, andererseits fügen sie sich
zu einer großen Bibliothek zusammen, eine Bibliothek, die
gleichzeitig zu einer großen Schicksals- und Interessengemeinschaft
wird. Walter
Grond stellte sich in seinem
Referat denn auch als zum Manager mutierter Autor dar, dem es vor
allem darum geht, das vorhandene Wissen in der Welt zu sammeln und
gut zu organisieren. Der Autor wird bei Grond ganz zum Wissensmanager.
Nach der politischen Vorgeschichte Gronds in der Steiermark liegt
es daher sehr nahe, seine Arbeiten quasi als Fortsetzung der früheren
Managerarbeit am Stadtforum in Graz zu sehen, diesmal aber vollkommen
unabhängig von allen österreichischen "Politkungeleien”
im autonomen und globalen virtuellen Raum. Aus dem Projekt "house”
ist Walter Gronds virtuelles Stadtforum geworden. "Vielleicht sollte ich mir weniger
Gedanken über das Schreiben
Michael Charlier schreib diesen Satz in der Mailingliste Netzliteratur am 24.07.2000. Ein solches Motto hätte man sich auch von den Teilnehmern der InterSzene gewünscht. Denn bei allen Diskussionen stand in Romainmôtier stets der Autor und die Frage nach der Authentizität im Vordergrund. Praktisch immer nahmen die Diskutanten auf die Situation des Autors Bezug, praktisch nie auf die des Lesers. Dabei waren doch unter den Geladenen nicht nur Autoren, sondern auch zahlreiche Theoretiker und Kritiker, also professionelle und geschulte Leser. Doch auch Theoretiker und Kritiker fühlen sich offensichtlich dem Autor stärker verbunden und damit bemüßigt, seine Vorherrschaft zu verteidigen. So kann denn ein Fazit der InterSzene relativ schnell gezogen werden: Der Leser selbst und sein Standpunkt blieben weitgehend unbeachtet. Dabei müsste doch in der Gelehrtenwelt normalerweise eher das Motto gelten, das auch bereits am Fachkongress "Elektronisches Publizieren” im Rundgespräch zu Netzkunst in München gefallen war: "Was der Autor sagt, ist nicht interessant, was der Leser daraus macht aber sehr.” So ist denn festzustellen, dass im
Diskurs die Position des Lesers weitgehend unberührt blieb.
Wenn man annimmt, dass der Autor ein Regelwerk zur Verfügung
stellt – laut Uwe Wirth zum Herausgeber mutiert –, das
der Leser als Performer benützen oder bedienen kann, so stellt
sich doch die Frage nach der Art der Performanz des Lesers, nach
den interaktiven Vorgängen sowie allgemein nach der Veränderung
der Position des Lesers. Ist es tatsächlich eine rigorose Veränderung
seines Standpunktes und seiner Rolle, die der Leser in den Hyperfictions
und interaktiven Narrationen erlebt im Vergleich mit dem Leser eines
Buchromans? Oder bleiben sich die Positionen von Autor und Leser
nicht in etwa gleich, weil der Rezipient nur Strukturen nutzen kann,
die der Autor oder Herausgeber vorgegeben hat? Gibt es hier Unterschiede
zwischen Einzelwerken und kooperativen Werken, welche Rolle spielt
in dieser Frage die gewählte Darstellungs- und Übermittlungsform? © Beat Suter; 5. August 2000 InterSzene / 14.-16. 7. 2000 / Romainmôtier |