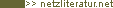
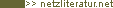 |
|
Reinhard Döhl
Akustische Poesie / Ein Exkurs Teil der akustischen Kunst ist die akustische Poesie, der auch mein drittes Fallbeispiel für Text als Partitur zugerechnet wird, in deren Geschichte ich Kurt Schwitters "Sonate in Urlauten" aber zunächst einzuordnen habe. Unter akustischer Poesie verstehe ich dabei eine Poesie, die auf das Wort und den Satz als Bedeutungsträger (weitgehend) verzichtet und in der methodischen und/oder zufälligen Addition von Lauten, Lautfolgen und Lautgruppen ästhetische Gebilde hervorbringt, die der akustischen Realisation bedürfen. Der Terminus akustische Poesie subsummiert dabei alle möglichen Bezeichnungen wie "Verse ohne Worte", "Lautgedicht", "Poemes phonetiques", "Poesie phonetique", "Poesie phonique", "Zaumnyj jazyk" usw. Eine Orientierung über akustische Poesie war bis zum Erscheinen von Christian Scholz' "Untersuchungen zur Geschichte und Typologie der Lautpoesie" (1989) dadurch erschwert, daß weder fundierte historische noch systematische Untersuchungen zu diesem Thema vorlagen, daß wichtiges Material praktisch unzu-gänglich war und erst einmal mühsam erschlossen werden mußte. Und: daß die germanistische Fachwissenschaft an solchen Untersuchungen überhaupt nicht interessiert war. So habe ich 1964 eine erste Skizze der akustischen Poesie (an die ich mich im Folgenden halten werde) nur in einer hektographierten literarischen Studentenzeitschrift unterbringen können, hat Scholz 20 Jahre später noch lange nach einem Doktorvater suchen müssen. Bis Ende des 19.Jahrhunderts weist die Literaturgeschichte eine Fülle von Onomatopoien, von lautmalerischen Imitationen auf (etwa der Frosch- und Vogelstimmen bei Aristophanes), von Wortschöpfungen zum Zwecke der Klangmalerei. Berühmt geworden und immer wieder zitiert, in Wielands "Abderiten" ebenso wie in Joyce's "Finnigans Wake", sind das Quoax Quoax der Aristopha-nischen Frösche oder das Nachtigallen-Gedicht Mario Bettinis: Quitó. quitó, quitó, quitó,Eine weitere Vorstufe zur akustischen Poesie dürfte in Wortverdrehungen und Wortverballhornungen anzunehmen sein. Auch hier bietet die Literaturgeschichte ausgiebiges Beispielmaterial (z.B. in den "Wispiliaden" Mörikes, in den (italiänischen) Märchen Brentanos; und natürlich bei den Sprachknetern der humoristischen Literatur und der Unsinnspoesie). Der erste Beleg für eine akustische Poesie im heutigen Sinne dürfte jedoch erst beim jungen Stefan George zu finden sein. George hatte in seiner Schulzeit (also vor 1888) versucht, mit klangvollen Silben klangvolle Wörter und mit diesen klangvolle Verse zu bilden. Man weiß von einem Versuch Georges, den ersten Gesang der "Odyssee" in diese eigentümliche Sprache zu übersetzen, die demnach auch so etwas wie eine eigene Grammatik und einen eigenen Wortschatz gehabt haben mußte. Durch eine solche Umschrift wurde der homerische Text allerdings in einen letztlich nur akustisch rezipierbaren Zustand gesetzt (was angesichts seiner ursprünglichen Mündlichkeit nicht ohne Reiz war). Zwei Zeilen dieses Experiments sind erhalten geblieben. Sie finden sich in der letzten Strophe des späteren Gedichtes "Ursprünge": Doch an den flusse im schilfpalasteEin weiterer und bekannter gewordener Versuch Georges, eine künstliche Sprache zu erfinden - die sogenannte Lingua romana - steht dagegen nach Georges eigenen Worten in keinem zusammenhang mit den erdachten sprachen der kindheitsstufe, und konnte dies schon deshalb nicht, weil sie - z.B. in Briefen - der Mitteilung von Inhalten diente. Nach eigenen Angaben, die nicht allzu wörtlich genommen werden dürfen, schrieb Else Lasker-Schüler ihr erstes, 1902 erschienenes Buch "Styx" ebenfalls in einer 'fremden' Sprache, und bemerkte zu ihm 1925 in der Abrechnung mit ihren Verlegern, "Ich räume auf": Die Gedichte meines ersten Buches: Styx, das im Verlag Axel Juncker erschien, dichtete ich zwischen 15 und 17 Jahren. Ich hatte damals meine Ursprache (! erläutern) wiedergefunden, noch aus der Zeit Sauls, des Königlichen Wildjuden herstammend. Ich verstehe sie heute noch zu sprechen, die Sprache, die ich wahrscheinlich im Traume einatmete. Sie dürfte sie interessieren zu hören. Mein Gedicht Weltflucht dichtete ich u.a. in diesem mystischen Asiatisch. [...] Elbanaff:In "Styx" publizierte Else Lasker-Schüler nur die deutschsprachige Version, von der die Forschung annimmt, das sie in einer Krisensituation entstanden sei: nach dem Ausscheiden aus der Vereinigung "Die Neue Gemeinschaft" der Brüder Hardt und nach der Scheidung der ersten Ehe mit dem Arzt Berthold Lasker, was man dem Gedicht in der "Styx"-Fassung auch durchaus abhört: WeltfluchtIch kann hier nicht auf Fragen eingehen, die dringend geklärt werden müßten, so unter anderem, ob es sich hier wirklich um einunddenselben Text in zwei Sprachen oder nicht vielmehr um eine Mystifikation der äußerst phantasiebegabten Autorin han-delt. Folgt man jedoch ihren eigenen Angaben, hätte man es, anders wie bei Stefan Georges Versuch, die "Odyssee" in eine künstliche Sprache zu übersetzen, bei Else Lasker-Schüler mit der Flucht in eine, mit der Restitution einer Art (geheimer) Ursprache zu tun, was auf merkwürdige Weise auf die späteren Zürcher Versuche Hugo Ball vorausweisen würde. 1897 erschien in Paul Scheerbarts "Ich liebe dich! Ein Eisenbahnroman mit 66 Intermezzos" auch folgendes 'Zwischenspiel': Kikakoku!Aus dem fantastischen Kontext läßt sich vermuten, daß es bei diesem Gedicht Scheerbart um die Erfindung einer unverständlichen, fremdartig anmutenden Sprache ging, vermutlich aber noch nicht um das Laut- und Sprachspiel als solches. 1898 publizierte Scheerbart in dem 'fantastischen Königsroman' "Na Prost!" ein weiteres mal zwei Texte dieser Art, die offensichtlich gleichfalls auf fantastische Sprache zielen. 1905 erschien dann Morgensterns berühmtes "Das große Lalulâ" im Kontext der Galgenlieder: Kroklokwafzi? Semememi! Hontraruru miromente Simarar kos malzipempuMehr als bei Else Lasker-Schüler und Paul Scheerbart ist hier der traditionelle Charakter des Gedichtes gewahrt worden. Doch gilt wohl auch hier die Absicht (wenn auch mit stärkeren sinnlichen Realbezügen), eine Art fantastischer Sprache, eine - wie Morgenstern es nennt - phonetische Rhapsodie zu erfinden (möglicherweise analog zur rudimentären Sprache der Kinder). Der biographischen Einlassung eines Briefes aus dem Jahre 1912 läßt sich zusätzlich entnehmen, daß Morgenstern noch als Gymnasiast 'Sprachen erfunden' [hat und] seinerzeit einer der eifrigsten Volapükisten war. Aber nicht nur das, er war auch - wie später Duchamp unter anderen Voraussetzungen - ein Schachspieler, und so erklärt er angesichts der Popularität, die "Das große Lalula" schnell gewann, den Text als von seiner Bedeutung her überschätzt. Er sei einfach Ein Endspiel. Keiner, der Schachspieler ist, wird ihn je anders verstanden haben. Um aber auch Laien und Anfängern entgegenzukommen, gebe ich hier die Stellung: / Kroklokwafzi? = K a 5 = (weißer) König a 5. Das Fragezeichen bedeutet, ob die Stellung des Königs nicht auf einem anderen Felde vielleicht noch stärker sein könnte. Aber sehen wir weiter. / Semememi! = S e 1 = (schwarzer) Springer e 1. Das Ausrufezeichen bedeutet starke Position. / Bifzi, bafzi = b f 2 und b a 2 (weiß). Versteht sich von selbst. / Entepente = T e 3 = (weißer) Turm e 3. / Leiolente = L e 2 = (schwarzer) Läufer e 2. / kos malzipempu silzuzankunkrei (sehr interessant!) = K a 4 oder 6 = König (schwarzer König) a 4 oder a 6. Nun ist dies aber nach den Schachregeln unmöglich, da der weiße König auf a 5 steht. Liegt also hier ein Fehler vor? Kaum. Das eingeklammerte Semikolon beweist, daß Verf. sich des scheinbaren Fehlers wohl bewußt ist. Gleichwohl sagt er durch das Rufzeichen: "Laßt ihn immerhin stehn". Nun gut, vertrauen wir ihm, obschon kopfschüttelnd. / dos = D 6 oder 7 = (weiße) Dame auf einem Feld der sechsten oder siebten Reihe. Weiß ist si stark, daß seine Dame auf jedem Felde dieser beiden Reihen gleich gut steht. / Siri Suri Sei (aha! Nun klärt sich K a 4 oder 6 auf!) S 6 = weißer Springer 6 (sei, italienisch = 6.) Ja, aber auch welchem Felde? Nun eben! Dies ist nicht näher bezeichnet. Der Springer wird daher den Platz des schwarzen Königs neben dem weißen König einnehmen und diesem dafür überlassen, sich in der sechsten Rei-he oder, falls da die Dame stehen sollte, in der vierten Reihe einen bequemen Platz zu suchen. So ist denn alles zur Zufriedenheit erledigt. (Im übrigen ergibt der vierte Teil der um zwei verminderten Buchstabensumme der drei Strophen die Zahl 64. Sapienti sat. [= Dem Wissenden genügts.] Daß Morgenstern noch bis in die 60er Jahre hinein Einfluß auf die unterschiedlichen Künstler hatte, belege ich im Vorbeigehen mit einem Gedicht des Material- und Objektkünstlers Heinz Hirscher, einer unüberhörbaren Hommage auf "Das große Lalulâ". Pertentingo Pertentingo O solesko PertentingoSowohl Scheerbart, als vor allem Morgenstern gehören mit ihren Texten überdies in einem weiteren Sinne in den Bereich der Unsinnspoesie. Sie zeigen noch etwas Spielerisches, gewissermaßen Leichtsinniges, das mit dem Auftauchen der Lautpoesie im russischen Futurismus und Dadaismus zu verschwinden scheint, wo zur Produktion akustischer Poesie dann zum ersten Male die theoretische Begründung tritt. Während der italienische Futurismus auf das Wort als Bedeutungsträger, auf die semantischen Bezüge nicht verzichten wollte, und mit den "parole in libertà" lediglich einen neuen, stark visuell bestimmten Gedichttyp entwickelte, gehören mindestens zwei Vertreter des in mancher Hinsicht viel radikaleren russischen Futurismus in den Zusammenhang der akustischen Poesie. 1910 publizierte Velemir Chlebnikov das auf einen einzigen Wortstamm aufgebaute Gedicht "Zakljatie smechom" [= aufgebaut mit dem/durch das Lachen], ein Gedicht, das inzwischen den Wert einer Ikunabel hat. Peter Urbans verdienstvolle Chlebnikov-Ausgabe hat für diesen Text alleine 11 Übersetzungs- bzw. Ersetzungsversuche ins Englische, Französische und Deutsche, u.a. von Hans Magnus Enzensberger, Franz Mon, Gerhard Rühm und Oskar Pastior versammelt. Dieser Text ist noch keine reine Lautpoesie, aber in der Reduktion auf einen Wortstamm, die Wortwurzel smej bereits deutlich auf dem Wege zu ihr, was man dem Original besser als den Fassungen in anderen Sprachen abhören kann. Ich zitiere zum leichteren Verständnis jedoch zunächst den Übersetzungsversuch Gerhard Rühms: ach, auflacht, lachenschaftler!Zum Vergleich der Anfang von Velemir Chlebnikovs "Zakljatie smechom": O, rassmejtes', smechaci!1912 erklärt Velemir Chlebnikov in seinem Manifest einer transrationalen Sprache, "Zaumnyj jazyk" (Übersinnsprache) die primär nicht bedeutungsbezogene Kombination von Lauten und Wor-ten als das adäquate poetische Verfahren. Während es derart bei Chlebnikov also immer noch Worte mit abgeschwächter Semantik (Roman Jakobsen) gibt, eine Bedeutung rudimentär immer noch vorhanden bleibt, ist vor allem von Aleksej Krucenych für ca 1913 die Notation bedeutungsfreier akustischer Poesie belegt. 1923 schrieb El Lissitzky im Vorwort seiner Litho-Mappe "Die plastische Gestaltung der elektromechanischen Schau - Sieg über die Sonne": für die erste aufführung dieser elektro-mechanischen schau habe ich ein modernes stück, das aber noch für die bühne geschrieben ist, benutzt. es ist dies die futuristische oper 'sieg über die sonne' von a. krutschonjch, dem erfinder des lautgedichts und führer der neuesten russischen dichtung. die oper wurde 1913 in petersburg zum ersten mal aufgeführt. die musik stammte von matjuschin (vierteltöne) [...] einzelne gesangspartien sind lautgedichte [...]. Das erschrockene Spießerlied Das KriegsliedVgl. ferner das "Gedicht in metalogischer und Weltsprachen aus Lauten" und weitere Texte von Krutschonjch. Zwei Künstler, die in diesem Zusammenhang auch genannt werden müssen, sind 1. der den meisten nur als suprematistischer Maler bekannte Kasimir Malewitsch, der aber auch versucht hat, Gedichte aus den Elementen von Vokalen und Konsonanten zu komponieren. Malewitsch: "Lautgedicht". 2. möchte ich das "Laboratorium des Gehörs" in Erinnerung bringen, das sich 1916 Dziga Vertov einrichtete, der heute ausschließlich als Filmemacher ("Tschelowjek s kinoapparatom / Der Man mit der Kamera"; "Simfonija Donbassa / Donbas-Symphonie") bekannt ist. In seiner Autobiographie erzählt er nämlich, wie er sich als zwanzigjähriger Student der Musik für die verschiedenen Mittel dokumentarischer Aufzeichnungen der hörbaren Welt, für die Montage stenographischer Aufzeichnungen, für Grammophonaufzeichnungen u.a. zu interessieren begann. In meinem 'Laboratorium des Gehörs' macht ich sowohl dokumentarische Kompositionen wie auch musikalisch literarische Wortmontagen. [Schriften zum Film, München 1973, S. 158.] 1916 - um jetzt wieder in der Chronologie akustischer Poesie forztufahren - las Hugo Ball im Cabaret Voltaire eine Anzahl Texte vor, die er "Lautgedichte" (in anderem Zusammenhang "Klanggedichte") nannte. Er notierte dazu in seinem Tagebuch "Flucht aus der Zeit": Ich habe eine neue Gattung von Versen erfunden, 'Verse ohne Worte' oder Lautgedichte, in denen das Balancement der Vokale nur nach dem Werte der Ansatzreihe erwogen und ausgeteilt wird. Die ersten dieser Verse habe ich heute Abend vorgelesen. Ich hatte mir dazu ein eigenes Kostüm konstruiert. Meine Beine standen in einem Säulenrund aus blauglänzendem Karton, der mir schlank bis zur Hüfte reichte, so daß ich bis dahin wie ein Obelisk aussah. Darüber trug ich einen riesigen aus Pappe geschneiderten Mantelkragen, der innen mit Scharlach und außen mit Gold beklebt, am Halse derart zusammengehalten war, daß ich ihn durch ein Heben und Senken der Ellenbogen flügelartig bewegen konnte. Dazu einen zylinderartigen, hohen, weiß und blau gestreiften Schamanenhut. Ich hatte an allen drei Seiten des Podiums gegen das Publikum Notenständer errichtet und stellte darauf mein mit Rotstift gemaltes Manuskript, bald am einen, bald am andern Notenständer zelebrierend... gadji beri bimbaDas berühmteste Gedicht Hugo Balls in dieser Art wurde die "Elefantenkarawane", die damals mehrfach unter dem Titel "Karawane" typografisch raffiniert publiziert wurde: Jolifanto bambla ô falli bamblaFraglos ist dieses Lautgedicht stark illusionistisch, lautmalerisch. Auch bedarf es - so scheint es jedenfalls - einer gewissen Inszenierung: also eines Rahmens, den in unterschiedlichster Form spätere Interpreten wie das Stuttgarter "Trio ex voco" stets gewählt haben. Doch ist mir dies im Moment weniger wichtig als die Tatsache, daß Hugo Ball nach seiner Präsentation für sich eine Rechtfertigung seiner Lautgedichte suchte. Vor den Versen, notierte er nämlich am nächsten Tag in seinem Tagebuch, Vor den Versen hatte ich einige programmatische Worte verlesen. Man verzichte mit dieser Art Klanggedichte in Bausch und Bogen auf die durch den Journalismus verdorbene und unmöglich gewordene Sprache. Man ziehe sich in die innerste Alchemie des Wortes zurück, man gebe auch das Wort noch preis, und bewahre so der Dichtung ihren letzten heiligsten Bezirk. Man verzichte darauf, aus zweiter Hand zu dichten: nämlich Worte zu übernehmen, (von Sätzen ganz zu schweigen), die man nicht funkelnagelneu für den eigenen Gebrauch erfunden habe. Man wolle den poetischen Effekt nicht länger durch Maßnahmen erzielen, die schließlich nichts weiter seien als reflektierte Eingebungen oder Arrangements verstohlen angebotener Geist- nein Bildreichigkeiten. Zwei Jahre später (1918) begann Raoul Hausmann mit seinen "Poemes phonetiques". Wie schon Ball hat auch er sich rechtfertigend zu seinen Lautgedichten geäußert: In den Lautgedichten handelt es sich nicht nur um haltloses Gestammel anarchistischer Ungehemmtheit, sondern sehr oft um Wortballungen, die aus der Epimneme verschiedener Sprachen ins Bewußtsein steigen. Wenn wir die vielfachen Möglichkeiten, die uns unsere Stimme bietet, aufzeichnen, die Unterschiede der Klänge, die wir unter Anwendung der zahlreichen Techniken der Atmung hervorbringen, die Stellung der Zunge im Gaumen, der Öffnung des Kehlkopfes oder der Spannung der Stimmbänder, kommen wir zu neuen Anschauungen dessen, was man Wille zur schöpferischen Klangform nennen kann. Auch innerhalb des polnischen Dadaismus begegnet uns Beispielmaterial akustischer Poesie. So schrieb Stanislaw Mlodoieniec ein Gedicht "Moskwa", das folgendermaßen anfängt: tu-m czy-m ta-m?wobei dann das ganze folgende Gedicht aus dem Arrangement solcher und ähnlicher Silben besteht, die in der polnischen Sprache keinerlei Bedeutung haben oder assoziieren. Spätestens im Dadaismus ist also die akustische Poesie gewissermaßen Allgemeingut und Repertoirebestandteil der experimentellen Autoren geworden. Wir begegnen Beispielen u.a. bei Wieland Herzfeld ("Trauerdiriflog") oder bei Hans Arp, der neben wenigen reinen Lautgedichten gelegentlich gerne Zeilen akustischer Poesie mit Zeilen seiner Unsinnspoesie mischt oder die einen zu den anderen als Refrain hinzutreten läßt. In den zwanziger Jahren kommen schließlich noch zwei weitere wichtige Autoren mit ihrem akustischen Programm hinzu. Als erster (und heute gerne unterschlagen) der Sprecher des STURM: Rudolf Blümner. Herwarth Walden notierte über ihn anläßlich seines 50. Geburtstages in einem Sonderblatt des STURM (am 19. August 1923): Kunst ist die Organisation optischer und akustischer Phänomene...
Schreie - Laute - Töne - Worte heben und senken sich. Die Bindung
ihres Hebens und Senkens ist die Kunst des Sprechens. Rudolf Blümner
ist der Meister der Sprechkunst. Er hat als erster das Material dieser
Kunst wiedererkannt: den Tonfall. Die vom Sprechkünstler Rudolf Blümner für sich gezogene Konsequenz waren sprachliche Gebilde ohne semantischen Ballast. Für sie wurde in den zwanziger Jahren im STURM (aber auch außerhalb) gerne der Terminus "absolute Dichtung" verwandt. Als Beispiel mag ein Text gelten, den Blümner 1921 im STURM veröffentlichte, "Ango laina". Oiaí laéla aía ssísialuDas wesentliche bei diesem Text scheint die konsequente Akzentsetzung und damit die Akzentuierung des Sprechflusses zu sein. Denn während Morgenstern und Ball z.B. auf Akzente verzichten, während Ball in seinem Tagebuch von der Stimme spricht, der kein anderer Weg mehr blieb, als die uralte Kadenz der priesterlichen Lamentation anzunehmen, jenen Stil des Meßgesangs, wie er durch die katholischen Kirchen des Morgen- und Abendlandes wehklagt, während die Akzente bei Scheerbart oft wie zufällig, allenfalls wie Ansatzpunkte zu einer Akzentuierung, Ansatzpunkte einer Artikulation wirken, erscheint der akustische Text Blümners von vornherein artikuliert - und sieht man einmal von der Schwitterschen Ursonate ab - wohl das für die Entwicklung einer akustischen Poesie konsequenteste Beispiel zu sein. Kurze Zeit später - 1923 - erschien von Kurt Schwitters, der selbstverständlich die "absolute Poesie" Blümners und ihn auch persönlich kannte und schätzte, vgl. sein verbales "Porträt Rudol Blümer. Gedicht 30" von 1919, die "Merz-Grammophonplatte Lautgedicht von Kurt Schwitters, vom Autor selbst gesprochen" als MERZ 13, und erst 1932 als MERZ 24 die "ursonate" (erklärungen und zeichen zu meiner ursonate / ursonate). Diese "ursonate" ist aus einem Thema Raoul Hausmanns fömsböwö-zä-u entwickelt. Zwei Jahre hat Schwitters daran gearbeitet. Später ist er mit seiner "ursonate" regelrecht auf Vortragsreise gegangen. Daß Kurt Schwitters dabei von Sonate spricht, ja im Druckbild so etwas wie eine Sonatenform gewählt hat, wie immer man das bewerten will, scheint dabei ein wesentliches Indiz, ein Hinweis auf den Bereich der Musik. Und spätestens im Falle Kurt Schwitters' wäre von einem Überschreiten der Sprachgrenze nach einem anderen Medium hin, von einer Grenzverwischung zu reden. Bei ihr wird der Autor zum Instrument seiner Poesie. Und an diesem Punkte der Entwicklung werden dann - nachdem die Versuche zu einer akustischen Poesie erst einmal abbrechen, - in der Mitte der vierziger Jahre in Paris etwa die Lettristen wieder einsetzen. |
|
Copyright (c) by Reinhard Döhl (http://www.reinhard-doehl.de).
|